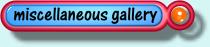Oben links der Netztrafo, rechts der Hochspannungstrafo, Pre-Regulator
(Phasenanschittschaltung für den HV Trafo)
und Leistungsendstufe.
In der Mitte unten die Referenzerzeugung und die Steuerungselektronik.

Hier die Power Abteilung im Detail

Und hier die Steuerung
Man beachte die linke Seite. Dort
steckt serienmäßig eine Extenderkarte. Eine sehr
servicefreundliche Lösung, die leider ein paar Jahre später
auch bei Fluke in Vergessenheit geraten ist.
Beim Reinigen des Gerätes gab es dann doch noch eine
Überraschung.
In der Leistungsabteilung oben hatte sich recht viel Schmutz
angesammelt, zur Reinigung habe ich das Pre-regulator-Modul und die
Endstufe entfernt. Ganz versteckt war dann das Ergebniss eines kleinen
Dramas zu sehen, dass sich vor langer Zeit abgespielt haben muss:

Der Widerstand war aufgeplatzt, hatte
aber seinen nominalen Wert von 5.1 Ohm nur um 1.2 Ohm erhöht. Was
da passiert ist, kann ich nicht nachvollziehen, irgend einen weiteren
Defekt, der zur Überlastung des Widerstandes geführt hat,
kann ich nicht finden. Es muss auch schon lange so sein, denn der
Widerstand roch nicht mehr. Wer weiß, wie bestialisch dieser
Widerstandstyp stinkt, wenn er abraucht, der versteht, was ich damit
meine...
Ich habe ihn selbstverständlich ersetzt, somit musste ich bis
jetzt genau 2 Bauelemente erneuern.
Hier noch ein paar weitere Bilder: (die Bilder kommen zu einem späteren Zeitpunkt)



Die eigentliche Spannungsreferenz befindet sich in dem runden,
schwarzen mit A3 bezeichneten Gehäuse links oben. Das Teil ist
thermisch stabilisiert und wird ganz schön warm. Hergestellt wurde
es von Texas instruments.

Die Phasenanschnitt Vorregler-Einheit für den HV Trafo.

Die Ausgangsstufe

Der Chopper-Verstärker. Zur
Entstehungszeit des Gerätes gab es noch keine ultra-low-offset
OpAmps, deswegen war diese Schaltungstechnik der einzig gangbare Weg um
driftfreie DC-Verstärker zu bauen. Die eigentliche
Signalverstärkung erfolgt hauptsächlich mit einem
µA709. Warum Fluke ausgerechnet diesen grauenhaften OP eingesetzt
hat verstehe ich nicht, 1978 gab es bereits besseres als diesen Typ.
Entsprechend aufwendig ist die Kompensation des OpAmp ausgefallen. Hier
sieht man auch den einzigen ersetzten Elko, C13.
An der Ausgangsspannung ist die Chopper-Frequenz an einem
angeschlossenen Oszilloskop praktisch nicht zu sehen, die
chopper-Einheit war immer noch sehr gut abgeglichen.

Finetuning für jede Schalterstellung

Probelauf nach Erfolgter Reparatur und Reinigung.
Der Fehler von 0.003% kam von dem noch nicht warm gelaufenen Messgerät.
Bei passender Gelegenheit
(Messmittelüberprüfung meines Arbeitgebers...) werde ich den
332B mit einem kalibrierten highend Laborgerät nachmessen, aber
auch so scheint mir bis jetzt alles plausibel, was das Gerät
ausgibt. Nach einer kurzen Warmlaufzeit stehen die eingestellten
Spannungen absolut stabil.
Er ist keine Schönheit, der 332B, aber ein wichtiges Instrument,
um seine Geräte zu überprüfen. Und dank des recht hohen
Ausgangsstroms von 50 mA könnte man ihn auch gut als
Hochspannungsnetzeil für Kleinsignal-Röhrenversuche
verwenden. Fast schon schade, dass ich mit Röhren nichts mache.
Aber als ich just im Baujahr meines 332B meine Berufsausbildung als
Funkelektroniker (= Radio und Fersehtechniker) abschloss, hatte ich
noch so viel mit alten Röhrenkisten zu tun, dass mir die
Faszination für diese Technik bis heute völlig abgeht. Seit
dem darauf folgenden Studium habe ich keine Röhre mehr
angefasst.... Jetzt steht noch die Reinigung der völlig
verdreckten Buchsen an, dann kommt er zu seinen "Kollegen" 5200b und
540B ins Regal.
Bleibt die abschließende Frage: Braucht man so etwas als Privatanwender und lohnt sich der Zeitaufwand?
Nun, wenn man Frage 1
konsequent zu Ende denkt kommt man zu dem Schluss, dass es
eigentlich auch genügt als Eremit in einem Erdloch im Wald
zu leben...
Und zu Frage 2: ja, das
lohnt sich. Alleine schon wegen der Erfahrungen, die man an der
nachvollziehbaren Schaltungstechnik dieser alten Geräte sammeln
kann. Und keine Freizeitaktivität ist wirklich "sinnvoll", die
Frage stellt sich einfach nicht. Es ist zudem ein schönes
Gefühl ein Gerät, was mal sehr teuer war, vor dem Schrott
bewahrt zu haben. Ich möchte damit auch mal ein
ausdrückliches Dankeschön an Firmen wie u.a. die Firma
H..... S..... in Aachen aussprechen, die es einem ermöglichen zu
einem fairen Preis als Privatanwender alte Hightech-Geräte zu
erwerben, die man sonst nur in Laboren oder Instituten zu sehen bekam
und allenfalls von weitem anschauen durfte. Sie könnten es sich
auch einfach machen und das alte Zeug einfach gleich verschrotten.
Karl-Heinz
L. sendete die Fotos und den Text zu diesem wunderbaren Standard,
vielen Dank für die Unterstützung der Webseite.