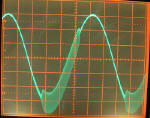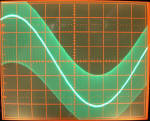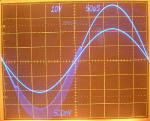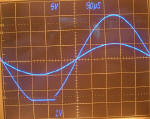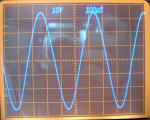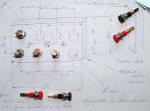|

|

|

|
|
Der Verstärker hatte ein langes und hartes Leben hinter, viel Staub
und Spuren von Rost angesammelt. Das Gerät dient als
Ersatzteilespender. Es ist eigentlich sträflich ein Gerät so
verkommen zu lassen. Eine Reinigung nach ein paar Jahren kann nie
schaden.
|
Ein zweiter baugleicher Verstärker soll repariert werden. Er ist
noch in einem ordentlichen Zustand. Kaputt, an den Endstufen hängt
der Ausgang fest auf +60 Volt. Ohne die eingebaute Schutzschaltung
wäre es das Ende für einen gleichspannungsgekoppleten
Baßlautsprecher gewesen.
|
Endstufenplatine Lötseite. An ihr wurde in der Vergangenheit
eindeutig schon gelötet. Zu sehen unten rechts auch der Halbleiter
Friedhof, alles defekte Endstufentransistoren. Bei vielen eine
niederohmige Verbindung zwischen Basis und Kollektor. Nicht einer
dabei ohne Kurzschluß, es müssen große Ströme geflossen sein.
|
Die
orginalen Endstufentransistoren sind die PNP Typen 2SA1065 und NPN Typen
2SC2489. Beide sind sehr schnell, sie sind schnelle bipolare
Leistungstransistoren (150V/10A/120W). Leider sind alle defekt.
Mitgeliefert sind ein paar neue 2SC2489 und ein Satz 2SB681 PNP und 2SD551
NPN (150V/12A/100W). Auf den ersten Blick passen diese als Ersatz recht
gut, der Verstärker wurde aber nicht für diese Typen kompensiert. Wenn der
Orginaltyp kaum noch erhältlich ist, helfen die üblichen Transistor
Vergleichstlisten. Diese Listen berücksichten aber nicht immer alle
Parameter. Falls ein anderer Transitortyp eingesetzt wird, immer genau
überlegen an welcher Schraube damit gedreht wird. In vielen Fällen ist es
möglich, oft sind sogar Verbesserungen damit erzielbar, aber auch das
Gegenteil ist möglich. Der Verstärker kann oszillieren und dabei können
sogar noch mehr Halbleiter kaputt gehen.
 |
|
Nach der Reinigung ist die Leiterplatte wieder sauber. Zu sehen
rechts und links die TO-3 Fassungen für die Endstufentransistoren,
die gesteckt sind und über die beiden Schrauben wird der Kollektor
(Gehäuse) kontaktiert. Die gesteckte Variante ist sehr
wartungsfreundlich. Die weißen Widerstände sind 0,47 Ohm
Widerstände, sie dienen zur lokalen Gegenkopplung und vereinfachen
auch das parallelschalten der Transistoren. Die Treibertransistoren
kommen anscheinend mit kleinen Kühlkörper aus. Glücklicherweise ist
das Service Manual vorhanden, ohne Schaltpläne wäre die Reparatur
eine mühselige Arbeit.
Zum schnellen Suchen von Fehlern in der Schaltung genügt bereits ein
einfaches Multimeter:
-
damit lassen sich die PN Übergänge mit
etwa 600mV an Basis-Emitter und Basis-Kollektor überprüfen.
Grobe Transitordefekte sind so erkennbar.
-
Dioden in Durchlaßrichtung zeigen etwa
300-600mV
-
Widerstände dürfen nie viel hochohmiger
sein als der Nennwert, ansonsten ist er sicher kaputt. Oft zeigt
der Ohmmesser aber einen niedrigeren Wert, liegt meist an der
Parallelschaltung mit anderen Bauelementen. Viele defekte
Widerstände zeigen ein "hochohmiger werden" bis hin zum
kompletten Ausfall. Der Teufel steckt jedoch im Detail, manchmal
gauckeln den Widerständen parallelgeschaltete Kondensatoren dem
Multimeter falsche Werte vor, es kann mehrere Sekunden dauern
bis die Anzeige steht.
-
im eingebauten Zustand die DC Spannungen
messen. Deutlich sicherer ist aber das Oszilloskop, es zeigt die
Kurvenform, das Multimeter ist in dieser Beziehung ungeeignet.
|
|

|

|
|
Die auf den ersten Blick - OK - Endstufe wurde nun beliebig am
linken Kanal angeschlossen. Sie wurde bestückt mit den
mitgelieferten 2SB681 und 2SD551 Transitoren. Das sind zwar nicht
die richtigen, aber der einzige Satz, der noch funktionsfähig ist.
Für Tests ist das in Ordnung auch wenn er hops gehen könnte.
Lautstärkeregler auf Null, Eingänge offen lassen und Power ON. Oft
beginnt eine Oszillation nicht sofort bei den kleineren Amplitude,
sondern erst mit größeren - also ein kleines Signal anlegen und
Lautstärke langsam aufdrehen und am Oszilloskop beobachten was
passiert, wenn der Sinus anfängt leicht zu oszillieren - Gefahr! -
Volume zurück - wenn das Scope dann doch plötzlich ganz "grün" wird
ist es oft zu spät - die Transistoren können kaputt gegangen sein.
Das Risiko einer sofortigen Oszillation besteht.
|
Leistungstransitoren im TO-3 Gehäuse. Montiert mit
Wärmeleitpaste und Glimmerscheiben zur elektrischen Isolation des
Kollektors zum Kühlkörper. Bei der Montage der Isolierscheiben
werden gern Fehler gemacht, daher mit dem Ohmmeter auf Hochohmigkeit
prüfen. Die Wärmeleitpaste ist ein widerliches Zeugs an den Fingern,
daß dann später auch überall am ganzen Tisch schmiert. Hier wurde
einst reichlich spendiert. Nur soviel auftragen, daß die
Oberflächenkratzer und Unebenheiten im Isoliermaterial, Gehäuse und
Kühlkörper ausgefüllt werden. Die Paste soll keine zusätzliche
aufbauende Schicht bilden, die den Wärmewiderstand verschlechtert,
wirklich nur Lücken füllen. Auch die Schrauben am Anfang nicht voll
anziehen, damit ein paar Tage später nach dem ersten Betrieb noch
etwas nachgezogen werden kann. Es dauert immer etwas bis sich die
Paste vollends setzt.
|
|

|
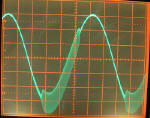
|
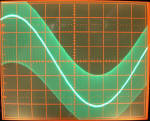
|
|
Nach dem ersten Einschalten ist der Verstärker stabil, ab ca. 25
Volt beginnt er leicht zu oszillieren.. 2 kHz ohne Last am Ausgang.
|
Wird nun die Amplitude noch weiter erhöht (10V/DIV), beginnt die
Oszillation sehr deutlich, vor allem in der negativen Halbwelle.
|
die Transitoren sind wärmer geworden, durch den permanent fließenden
Ruhestom. Die Oszillation wächst, langsam wird es Zeit abzuschalten.
|
|
Die Ursachen für eine Oszillation sind vielfältig, wahrscheinlich
ein Defekt im ersten Teil der Endstufe (lange Platine hinter den
großen Elkos). Wobei die falschen Endstufentransistoren diese
Oszillation mit begünstigen können.
|
|

|
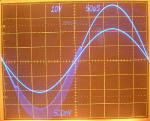
|
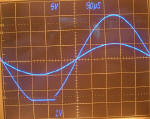
|
|
Nun wurde ein Versuch gestartet, wie sich die letzten verbliebenen
2SC2489 Orginaltransistoren auf den Ausgang auswirken.
|
Mittlerweile mal das Oszilloskop getauscht eines mit Readout. Das
Bild zeigt den Verstärker im Leerlauf mit PNP Ersatztransistor und
dem orginalen NPN in der positiven Halbwelle.
|
Beim Anlegen einer 4 Ohm Last wird der Verstärker stabil. Nur
merkwürdigerweise beginnt er bereits bei ca. -13 Volt zu clippen. Es
müssen noch Defekte vorliegen.
|
Power Amp
|
Nun
gilt es die lange Platine hinter den großen Elkos zu untersuchen.
|
|

|

|

|
|
In der langen Leiterplatte direkt hinter den großen Elkos steckt
sehr wahrscheinlich ein Fehler. Die beiden Kanäle sind symetrisch
aufgebaut, recht kurze Leiterbahnen, kaum Drahtverhau. Die
länglichen, schmalen, kleinen Transitoren sind Doppelfet's in der
ersten Stufe (etwa in der Bildmitte rechts und links), in einem
Gehäuse das ist vorteilhaft z.B. wegen den Drifteigenschaften
über Temperatur. Was eventuell kritisch geworden ist mit den Jahren,
die veringerte Kapazität der Elektrolytkondensatoren. Auch die
kleinen Potentiometer (oben) sind gern ein Problem, nur dran
rumdrehen wenn nötig, da außerhalb der Stelle wo der Schleifer all
die Jahre gestanden ist, die Oberfläche gern verschmutzt ist, da muß
ein paar mal dreht werden um die Ablagerungen mit dem Schleifer zu
entfernen.
|
den ersten Fehler schon gefunden, ein 180 Ohm Widerstand größer als
der Meßbereich von 2 kOhm. Der ist kaputt. Die umliegenden Bauteile,
insbesondere Halbleiter gilt es nun selbstverständlich auch zu
prüfen. Runter mit der Leiterplatte, manchmal einfacher gesagt als
getan. Zuerst ein paar Bilder machen, dient später als Hilfe um zu
wissen welcher Draht wieder wo rangelötet werden muß, ohne mühsam
den Schaltplan zu studieren. Wenn die Drähte weg sind, kommen noch
die Plastikclips.
|
Der Verstärker ist mit den Jahren schmutzig geworden. In der
Gegenwart sind Kondensatoren mit gleicher Kapazität bedeutend
kleiner geworden und auch besser. Trotzdem sehe ich bei denen
vorerst keinen Grund sie zu tauschen, sind fast immer noch ok, sind
auch nicht so billig. Zudem geht auch hier etwas Orginalzustand
verloren, obwohl mir das sonst eigentlich eher egal ist. Ein Messen
der Kapazität wäre interessant, aber nur wenn sie sich vernüftig
auslöten lassen. Wer keinen Kapazitätsmesser für hohe Kapazitäten
hat, kann dies auch so beurteilen: Verstärker z.B. mit 4 Ohm
belasten (ausreichend starker Lautsprecher geht natürlich auch), mal
richtig aufdrehen. Als Signalquelle ein Sinussignal und die
enstehende Ripplespannung am Kondensator mit dem Oszilloskop
beobachten. Bei einem schlechten Elko mit fallender Kapazität
jedenfalls wird ein hoher Ripple zu sehen sein.
|
|

|

|

|
|
Nur keine Hemmungen, der Dreck muß einfach runter von der
Leiterplatte. Eine milde Seifenlösung macht der Leiterplatte und der
Elektronik überhaupt nichts. Ein Reiniger ist auch vorteilhaft, da
er rückstandsfrei und gut abtrocknet, wie das Geschirr auch.
Selbstverständlich geht auch Spiritus, ist aber schon stärker in der
Wirkung, gibt gern leicht matte Rückstände auf der Leiterplatte und
ist die Empfehlung für den zweiten Waschgang. Der
Leiterplattenreiniger mit Plastikpinsel im Sprühkopf integriert,
liefert gute Reinigungsergebnisse. Für eine stark verdreckte Platine
braucht man aber viel davon. Bestens geeignet ist LR auch für
Lötrückstände aller Art. Es gibt zig Möglichkeiten eine Leiterplatte
zu reinigen. Kann schon sein, daß Wasser irgendwo in ein Bauteil
reinläuft, wo es im Neuzustand nicht reinlaufen würde, es ist ein
gewisses Risiko. Ein gewöhnliches Bauteil, daß wegen des Waschens
nun beschleunigt kaputt gehen würde, soll's doch ruhig gleich kaputt
gehen, ich schmeiß es raus, lieber bei mir als im nächsten Jahr bei
Dir im Wohnzimmer.
|
Nach dem Waschen ist die Leiterplatte trocken zu föhnen, aber nicht
mit den 2000 Watt, sondern so, daß man die Leiterplatte dabei immer
noch bequem mit der Hand festhalten kann. Also nicht zu heiß
einstellen. Eine Druckluftpistole trocknet auch gut. Nur an der Luft
trocknen lassen geht auch, die Wassernester, die man nicht sieht
bleiben aber sehr lange erhalten, sind beim Einschalten nicht so
toll. Ein Heizkörper tut gute Dienste. Wassernester bilden sich z.B.
in den Gehäusen der kleinen Potentiometer, diese müssen auf jeden
Fall ausgetrocknet sein vor dem Einschalten. Einen gewissen
Sachverstand erfordert die Reinigung schon. Eine saubere
Leiterplatte ermöglicht auch eine optische Inspektion. Auch wenn sie
funktioniert, es schadet nicht diese auch einmal unter einer Lupe
richtig zu betrachten. Feine Risse in den Leiterbahnen sind nie
auszuschließen, und mechanisch beschädigte Bauteile besser
erkennbar. Die Lötstelle kann man so auch besser beobachten oder
nachlöten.
|
Die Leiterplatte sieht nun wieder sauber aus. Die restlichen
defekten Bauteile auf dieser Leiterplatte, Transitor NPN 2SC2633 und
zwei dazugehörige Widerstände R48, 50 mit je 180 Ohm. Im anderen
Kanal war Transitor 2SC2633 defekt, aber die Widerstände ok.
Warum auch immer die Endstufentransitoren kaputt gegangen sind, sehr
wahrscheinlich hat ein Defekt den anderen bewirkt. Durch den einen
intern kurzgeschlossenen Transistor liegt beispielsweise eine zu
hohe Spannung an dem Widerstand, die hohe Leistung macht ihm den
Garaus und er geht mit defekt. Es ist nicht immer vorhersehbar ob
ein Transistor im Defektfall kurzschließt oder hochohmig wird, hängt
von der Fehlersituation ab, aber auch vom inneren Aufbau, was gibt
z.B. zuerst nach: die Bonddrähte (wird hochohmig) oder das Silizium
(kann schmelzen, niederohmig).
|
Die
Bilder mit dem vielen Wasser, Seife und dem Waschbecken
haben seit der Veröffentlichung teils negative Meinungen
verursacht, das war so nie gedacht, es war lediglich eine
Erzählung wie ich es gemacht habe.
Manche glauben nicht, dass man sehr schmutzige Elektronik bei
Bedachtheit auch nass reinigen kann. Ich wurde deswegen schon
mehrfach öffentlich für wörtlich "verrückt" erklärt Elektronik
mit Wasser zu reinigen. Gerade deswegen bleiben die Bilder drin
und diese Anmerkungen kommen ergänzend hinzu:
Warum soll nun Wasser gefährlicher sein als teils scharfe
Reinigungsmittel, für die man sich teilweise sogar Handschuhe
anziehen sollte?
In manchen industriellen Bereichen werden bestückte
Leiterplatten nach Rparaturen auf Kundenwunsch sogar "GEBADET"
über einen längeren Zeitraum in Alkohol, damit wirklich alle
Schmutzreste und Lötflußmittel Reste restlos entfernt sind.
Teilweise wird dies nach Reparaturarbeiten sogar gefordert.
Reinigen mit Alkohol entspricht anerkannten Richtlinien. Selbst
Hinweise auf das Reinigen mit milden Wasserlösungen und dem
Nachspülen mit klarem Wasser, dies kann man sogar in manchen
Instruction Manuals der Geräte Hersteller nachlesen.
Wenn ich Alkohol, Industriereiniger oder sogar "audiophilen
Spezialreiniger" genommen hätte, würde keiner dieser Leute
danach krähen, "Alkohol oder Spezialreiniger" hört sich ja auch
irgendwie "industrieller, professioneller und beruhigender" an.
Der schärfere Alkohol reinigt besser und wirksamer und er
verdunstet hinterher deutlich schneller, das sind seine
unverkannten Hauptvorteile. Zeit ist ein Faktor im industriellen
Bereich, deswegen kommt dort kaum einer auf die Idee Wasser
zuverwenden, wegen der ganz klar erhöhten Trockenzeit und das
Risiko der Leitfähigkeit bei nicht restlos entferntem Wasser.
Ich habe auch nirgends geschrieben, daß man Wasser in einen
offenen Trafoaufbau reinlaufen lassen sollte wo man es hinterher
nur schwer wieder rauskriegt, oder? Da würde ich selbst mit
Alkohol nicht gerne waschen. Ein wenig denken muss man schon was
man tut, dieses digitale Denken "Spezialreiniger passiert
nichts" "Wasser ist der Teufel" ist sowieso falsch, es gibt
immer Zwischenzustände.
Oxidation durch das Wasser ist bei einer derat geringen
Einwirkzeit wohl eher als bescheiden anzusehen, selbst auf
Kontakten. Zumal solche hinterher mit Kontaktpflegespray
behandelt werden.
Warum nehme ich keinen Spiritus zum Baden oder Waschens des
Verstärkers sondern Wasser? Ja schaut mal (richtet sich an die
Kritiker) soll ich jetzt im Ernst wegen Euch eine Wanne mit
zwanzig Liter Spiritus füllen nur um den ganzen Verstärker darin
zu baden oder gleich den hochreinen Alkohol ohne
Vergällungsmittel, welches gern weißliche Flecken hinterläßt?
Ich kann daher nur die Empfehlung geben, lasst Eure alten Kisten
nach einer Reparatur lieber versifft und dreckig oder kauft für
fünfhundert Euro 1 Liter audiophilen Spezialreiniger,
zusammengemischt von einem Instrumentenbauer, Tontechniker,
Fach-Ingenieur oder einem Berufsmusiker. Ist es das was Kritiker
hören wollen? (Die Auflistung dieser Berufe ist keineswegs
abwertend gemeint, es ist nur ein Wortspiel).
Es soll jeder das tun was er für richtig hält und respektieren,
daß jegliche Methode ihre Vor- und Nachteile hat. Ich jedenfalls
habe noch keinen für "verrückt" erklärt nur weil er entweder mit
Wasser, Alkohol, Spezialreiniger, Wattestäbchen oder überhaupt
nichts reinigt.
Wenn dieser Verstärker nicht hätte repariert werden müssen,
hätte ich ihn sowieso nicht gereinigt, ein funktionierendes Hifi
Gerät im Innern zu putzen nur so zum Spaß - nein danke, mach ich
auch nicht - dazu gibt es keinen zwingenden Grund.
Bei einer Instandsetzung hingegen,
wenn das Gerät sowieso schon zerlegt ist putze ich lieber erst
mal und zwar aus diesen Gründen:
- im sauberen Zustand erkennt man manche
Fehler (manche im verschmutzen besser)
- die Finger bleiben sauberer
- die Farben der Drähte sind wieder besser
zu erkennen zur Signalverfolgung
- Lötarbeiten an sauberen Leiterplatten
gehen einfacher
- hochohmige Schaltungen arbeiten besser im
sauberen Zustand (sind jedoch keine drin)
- sieht schöner aus
Es ist einfach traurig wenn man die
einfachsten Dinge ausgiebig und breitgetreten in jedem Detail
erklären muss, da es sonst anscheinend von manchen mißverstanden
wird.
|
|

|

|
|
Wenn schon denn schon, wird alles sauber gemacht. Siehst Du wie das
Kupfer wieder schön glänzt? Die inneren Leiterplatten sind bereits
alle unten, da lohnt es sich die Grundplatte zu putzen. Drauf mit
dem Wasser, Seifenlösung und der Bürste. Vorher aber gründlich
überlegen wo nur wenig Wasser drauf soll. Z.B. bitte nicht die
Trafos und Relais. Natürlich so wenig wie möglich in die Potis oder
den Lautstärkeregler, der vordere Teil (Potis und Schalter) und
hintere Teil (Vorverstärker) läßt sich hier gut abdecken.
|
Die Sicherungen glänzen sogar wieder ein wenig. Auf der großen
Platine ist nur grobes Holz an Bauteilen drauf, denen das Wasser
nichts macht. Das vollständige Zerlegen und reinigen der großen
Platte, wäre so viel Arbeit, die sich kaum rechnet, die ganzen
zehntausend Drähte und Kabel ab und wieder anzulöten - nein danke -
das geht hier auch mal anders.
|
|

|
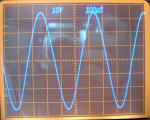
|
|
Teilespender für die defekten Transitoren
|
Zunächst keine weiteren defekten Bauteile mehr gefunden, der
Zeitpunkt zum Zusammenbau kribbelt in den Fingern.
|
|
Siehe da, eine der beiden Endstufe mit den Ersatztansistoren läuft
an beiden Kanälen der langen Platine. Das Foto zeigt die
Ausgangsspannung an einer 4 Ohm Last. Ich habe hier mal aufgedreht
auf 36 Volt Amplitude bei einer Frequenz von 2600 Hertz. Es geht
noch ein klein wenig mehr Amplitude, danach beginnt der Verstärker
jedoch mit Clipping. Diese 36 Volt an 4 Ohm bringt er am Scope mit
den nicht orginalen Transitoren. Der Kühlkörper wird dabei sehr
warm, für Dauerbetrieb mit solch einer sinusförmigen Belastung nicht
zu empfehlen.
Spitzenleistung sind das:
RMS Watts damit ist die Leistung in Wärme gemeint, die eine dem
Sinus gleichwertige Gleichspannung im Widerstand in Wärme umsetzen
würde. In anderen Worten: die gezeigte Sinusspannung mit der
Amplitude von 36 Volt würde den Lastwiderstand auf eine bestimmte
Temperatur aufheizen. Eine Gleichspannung von 36 Volt/1.414 = 24,445
Volt würde den Lastwiderstand genau auf die gleiche Temperatur
aufheizen wie die Sinusspannung.
|
Lautsprecheranschlüsse
|

|

|
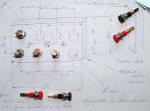
|
|
Es war ein Wunsch die orginalen Lautsprecherkabel Anschlußklemmen
gegen Bananenbuchsen zu ersetzen.
|
Der schwarze Buchsenträger muß ausgelötet werden, die Bananenbuchsen
sind einfach nicht darauf montierbar.
|
Als Träger soll nun ein kleines hübsches Holzbrettchen dienen, daß
dann von hinten auf die Rückwand geschraubt wird. So schreibt sich
"Fase" richtig.
|
|
Über die Maßnahme mit dem Brettchen kann man sich streiten. Rein
elektrisch (ohmscher Widerstand) bringt es nichts, vielleicht das
hier: ein vergoldeter Bananenstecker und vergoldete Buchse oxidieren
über Jahre hinweg nicht, der Kontaktwiderstand bleibt konstant,
solange die Federkraft erhalten bleibt (vernickelt geht natürlich
auch). Manche Schraubklemmen lockern sich mit der Zeit ein wenig,
kontrollieren ist da gelegentlich nicht verkehrt. Vorteilhaft ist
die Bananenstecker Lösung auch, da ein Kurzschluß eigentlich nur
schwer hinzubekommen ist. Wenn man bedenkt, daß bei beiden
Verstärkern die Endstufentransistoren kaputt gegangen sind, so ist
die Kurzschlußgefahr gar nicht mal so auf die leichte Schulter zu
nehmen. Wie schnell passiert es, daß ein paar Kupferadern nicht
richtig untergeklemmt werden und sich Plus und Minus berühren?
Besonders dann wenn man es eilig hat, das Licht schlecht ist usw.
Ja, das ist ein Vorteil der Bananenbuchsen, Schluß mit dem Gefummel,
verschiedene Lautsprecher und Verstärker ruck zuck austauschbar.
Nett aussehen wird es bestimmt auch.
|
|

|


|

|
|
Ein Brettchen aus massivem Nußbaum Kernholz tut gute Dienste. Zeigt
den unbehandelten Zustand.
|
Eingebaut sieht die Kombination Brett und Buchsen nett aus. Das Holz
wurde zum Schutz mit einem Hartöl eingerieben, als Holzschutz und
gleichzeitig ein wenig mehr Farbe und Glanz.
|
Die einzige Quelle, die ich fand, die gleichzeitig den PNP und NPN
Typen am Lager hatte.
|
 |
 |
 |
|
Inzwischen sind auch die neuen Kondensatoren angekommen und warten
auf den Einbau. Verwendet werden keine "Billigst" aber auch
keine "Teuerst" Kondensatoren. Man kann endlose Diskussionen darüber
führen was das Beste ist. Das Beste gibt es nie, jede Lösung hat Vor
und Nachteile.
|
Der
Ausbau der Lautsprecheranschlüsse erfordert Wärme und Geduld. Hier
hat ein Heißluftföhn mit schmaler Luftdüse gute Dienste geleistet.
Bei einem Anschluß hat sich leicht das Kupfer aufgewellt, verzeih's
mir.
|
Die
mit Spiritus gereinigte Leiterplatte wieder eingebaut. Drähte sind
typisch für Großserien kurz gehalten, um Kosten zu senken, sowie um
elektrisch kurz zu bleiben. Beim Reparieren gelegentlich nervend.
|
 |
 |
 |
|
Das
war eine Idee die Platte mit den Buchsen zu verbinden - hat nicht
funktioniert. Dünnere besser biegsame Drähte wurden verwendet, oben
mit flexiblen isolierten Leitungen, damit genügend Abstand zu den
störenden Widerständen eingehalten werden kann. Die Anschlüsse der
orginalen Plastik Lautsprecherbuchsen, sitzen nicht mittig wie die
Bohrungen.
|
Die
Leiterplatte im eingebauten Zustand. Hier geht es eng zu. Die
Gefahr, daß sich irgendwo blanke Buchsen und z.B. die Drähte der
Widerstände berühren ist gegeben, d.h. die Platte präzise einbauen
und auf genügend Isolation achten und vor allem danach überall gut
kontrollieren.
|
Eingebaut sieht das kleine Nußbaumbrettchen gut aus und passt zum
Schwarz des Gehäuse. Die Imbusschrauben lassen sich einfach
festziehen. Die Größe passt genau, so daß das Plus und Minus Symbol
noch sichtbar bleibt.
|
|
Der Einbau des
Brettchens erfordert schon etwas Geschick, Geduld und Zeit, aber
jetzt ist es drin. Vielleicht wäre der Einbau für Dich handwerklich
auch kein Problem, aber jemand der elektrotechnisch wenig erfahren
ist, kann hier schnell einen Bock schießen, ein kleiner
neugeschaffener übersehener Kurzschluß kann die Endstufe
beschädigen. Also entweder Finger weg oder nachher wirklich ganz
genau nachsehen.
|
Endstufen
 |
 |
 |
|
Nun
geht es an die Leiterplattenseite der Endstufen. Zuerst eine
Reinigung mit Spiritus und Pinsel. Da sind noch Flußmittelreste
drauf und eine werksseitige Schutzschicht, die mittlerweile
ordentlich mit Staub verschmutzt ist.
|
Die
Endstufe vom anderen Kanal ist genauso verdreckt, an ihr wurde aber
schon mal repariert, deutlich zu sehen an den nicht gereinigten
Lötstellen, voll mit Flußmittelresten. Elektrisch macht das bei
einer niederohmigen Endstufe nicht viel aus, ist aber unschön.
|
die
Bauteilseite der rechten Endstufe ist auch noch verschmutzt, der
Staub muß weg. Krumm und bucklig eingebaute Widerstände.
|
 |
 |
 |
|
Auch
dieser alte Siff, die überschüssige mittlerweile verdreckte
Wärmeleitpaste muß jetzt runter. Immer die Hände verschmiert egal wo
man hinlangt. Mit einem Lappen kräftig wegwischen. Die
Glimmerscheiben werden natürlich auch geputzt und bei der
Gelegenheit auf Schäden kontrolliert. Aber Vorsicht die Scheiben
brechen leicht, nicht biegen.
|
Nach
der Spiritus Reinigung und dem Trocknen mit dem Heißluftföhn sieht
die Leiterplatte wieder richtig sauber aus. Sogar die
Emitterwiderstände glänzen wieder wie Zahnweiß aus der Werbung. So
macht es Spaß daran zu arbeiten. Das ist die linke Endstufe, die
bereits scheinbar lief, sie wurde mit A und C markiert (Hilfe
Plazierung der Transistoren)
|
Beginnen wir mit dem Tauschen der Elektrolytkondensatoren. Hier der
ausgelötete 47µF/10V. Ersetzt durch 47µF/25V. Der Fortschritt
der letzten Jahrzehnte macht sich auch in der Größe bemerkbar, ein
vergleichbarer aus alten Tagen wäre größer.
|
|
Bei der Montage der Endstufentransistoren unbedingt darauf
achten, daß kein Kurzschluß zwischen Transistorgehäuse (Kollektor)
und dem Kühlkörper entsteht. Nach jedem Tausch eines
Endstufentransistors muß dies mit einem Ohmmeter oder
Durchgangsprüfer unbedingt überprüft werden. Ein Ohmmeter kann aber
durch parallelgeschaltete Kondensatoren schwankende Werte anzeigen,
z.B. ein paar hundert Ohm, das ist normal. Aber auf keinenfalls nur
wenige Ohm - dann Verstärker in Gefahr ! Auch sicherstellen, daß die
Meßspitze blanken guten Kontakt zum eloxierten Kühlkörper hat,
Meßgerät zuvor prüfen.
|
 |
Getauscht wurde auch der Elko 1µF/50V. Bei dieser Kapazität bietet
es sich an gleich einen vorteilhafteren Folienkondensator zu
verwenden (der gelbe ist der neue 1µF/63V).
|
 |
|
Oha, was ist den
das? Defekter Widerstand mit 62 Ohm in der Endstufe rechts. Der ist
mir schon im verdreckten Zustand aufgefallen, die Oberfläche war
zwar noch ganz, nur war er an einer Stelle leicht bräunlich, das ist
oft ein Indiz für zu viel Wärme. Durch das Reinigen und das Drücken
mit dem Pinsel kam die Wahrheit ans Licht. Es zeigt wie schwach der
Trägerkörper bereits gewesen ist, das leichte Berühren mit dem
Pinsel ließ in brechen. Einem OK Widerstand macht das gar nichts.
Der kaputte Widerstand hatte möglicherweise noch etwas von
seinen Sollwert, so daß die Schaltung noch funktionierte, er wäre
aber ein eindeutiger Kandidant für einen Ausfall in der nächsten
Zeit. "Ein gewöhnliches Bauteil, daß wegen des Waschens nun
beschleunigt kaputt gehen würde, soll's doch ruhig gleich kaputt
gehen, ich schmeiß es raus, lieber bei mir als im nächsten Jahr bei
Dir im Wohnzimmer". Solch eine Bestätigung kommt wie gerufen.
|
|

|
|
Werfen wir doch mal einen Blick auf die Endstufe links. Der dort
eingelötete Widerstand mit 62 Ohm ist kein Orginalwiderstand, der
hat eine andere Bauform. Der Ersatz ist ein Standard 0,7 Watt
Metallschichtwiderstand. Aha, das ist auch die Endstufe an der schon
mal repariert wurde. Genau dieser R war auch schon mal kaputt.
Es ist reine Spekulation warum: R ist im Fehlerfall überlastet und
wird dabei mit in den Tod gezogen. Ein Blick in die Schaltung kann
das klären.
|
|

|
|
Wie wird der Widerstand ersetzt? Im Idealfall mit einem größeren 62
Ohm Metallschicht/Metalloxid Widerstand, z.B. ein 1-2 Watt
Widerstand. Ich hab aber z.Z. leider keinen größeren Metallschicht
mit 62 Ohm zur Verfügung. Man kann sich aber auch einen etwas
belastbaren 62 Ohm selber bauen. Beispielsweise aus vier Stück 0,7
Watt Standard Metallschicht, verschaltet so wie im Bild, hat
genügend maximale Verlustleistung und ist elektrisch und mechanisch
für diese Anwendung so in Ordnung.
|
 |
 |
|
die ankommenden Transistoren werden am Kennlinienschreiber getestet,
ob sie funktionieren und auch den Transport überstanden haben.
|
mit solch einem älteren schönen Röhrengerät, lassen sich die
Kennlinien von Transitoren darstellen. Hier ist ein NPN Transistor
angeschlossen. Die Transistoren sind alle in Ordnung.
|
 |
 |
|
An beiden Endstufen sind die 62 Ohm Widerstände ausgetauscht. An der
Endstufe links ist sogar noch deutlich unter dem R auf der Platine
ein brauner Fleck zu sehen, das hat als Ursache Wärme. Das ist die
Leiterplatte mit dem kleinen 62 Ohm, der bereits schon bei einer
früheren Reparatur einst getauscht worden ist.
|
So langsam wurde es spannend in der Endstufe links. Ein Blick in den
Schaltplan zeigt, daß R und D in Reihe liegen, eine Untersuchung der
Diode in der Endstufe links zeigt diese als defekt und in beiden
Richtungen hochohmig, also kaputt. Am Meßgerätedisplay (oberer
Bildrand) kann man "OPEN" erkennen, das war eine Prüfung in
Durchflußrichtung, normalerweise sollten im ok Fall ca. 600 mV sein.
Die Diode wurde ersetzt mit einer aus dem Teileträger.
|
 |
 |
|
Hier und heute wird weitergemacht
|
|
Nach Überlegung wurde
der Defekt der linken Endstufenseite klarer. Möglich, daß ein NPN
Endstufentransistor defekt ging durch einen hohen Strom (warum auch
immer). Die Kollektor-Basis-Strecke schmilzt zu einem Kurzschluß und
damit liegt R in Reihe mit der Diode plötzlich an +66 Volt, dabei
fließt hoher Strom durch den PNP Treiber, das ganze fließt zum Teil
auch weg in den Transistor auf der langen Power Amp Platte und kann
dort das zerstörerische Werk fortzsetzen. Ob das alles auch wirklich
so war, kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
|
 |
 |
|
In der Endstufe rechts, ist der Treibertransistor kaputt. Seine
Basis Emitter Strecke ist hochohmig. Wahrscheinlich ist auch die
rechte Endstufe über den gleichen Mechanismus gestorben wie die
linke Endstufe. Immer das gleiche kaputt: entweder R oder D, hier
jetzt sogar noch der Treiber und auch der Transitor + 180 Ohm
Widerstände auf der langen Platte.
|
Die
Treibertransistoren waren bei diesem Verstärker alle ohne
Wärmeleitpaste auf dem Kühlkörper montiert. Etwas
Wärmeleitpaste verbessert (laut Hersteller) den Wärmeübergang um bis
zu 50%. Die Treibertransitoren wurden ausgelötet, geprüft und danach
mit etwas Paste versehen.
|
|

|

|
|
Nach dem die Endstufen fertig und geprüft sind wurden sie
mit Schutzlack eingesprüht. Der Schutzlack ist ein seit vielen
Jahren in der Elektronik bewährter Schutzlack, er ist preiswert und
einfach anzuwenden. Die Oberseiten wurde nicht lackiert.
|
Beide Endstufen im lackierten Zustand. Der Lack ist durchlötfähig,
d.h. spätere Löt Reparaturen sind kein Problem. Am Markt gibt es
viele Elektronik Lacke für die unterschiedlichsten Anwendungen.
|
Power Amp
|

|

|

|
|
Nun
geht es an die lange Leiterplatte Power Amp hinter den dicken Elkos.
Der Lack an der Unterseite ist verschmutzt.. Sie wurde zuvor mit
Seifenwasser gereinigt, das enfernt aber nur das Grobe und den
Staub. Hier hilft ein lösendes Reinigungsmittel z.B. Spiritus.
|
Am
Power Amplifier sind alle Elektrolytkondensatoren gegen Neuteile
getauscht, dabei gab es auch ein paar Überraschungen. In der unteren
Hälfte liegt alles was an diesem Verstärker bereits getauscht worden
ist. Die Teile mit den weißen Kreuzchen sind alle defekt. In
dieser Leiterplatte waren zwei Elkos je 1µF/100V defekt, es
sind die beiden kleinen Elkos unten rechts.
|
Hier
noch ein Beispiel wie die Elektrolytkondensatoren kleiner geworden
sind. Sie wurden nicht nur kleiner, sondern elektrisch betrachtet
auch besser. Im Beispiel verbesserte sich der Verlustfaktor von
0.065 auf 0.018 und der Ersatzserienwiderstand ESR reduzierte sich
von 88 milli Ohm auf 25 mill ohm (@120 Hz gemessen mit einem
4282A).
|
|
Es waren fast alle
Elektrolytkondensatoren im Power Amp in Ordnung. Die orginalen
Kondensatoren zeigten nach all den Jahren keinen merklichen
Kapazitätsverlust, Verlustfaktor und ESR in Ordnung. Leckströme kaum
meßbar. Trotzdem lohnte sich das Tauschen gegen neue Kondensatoren,
die neuen Serien sind in ihren elektrischen Werten verbessert. Der
Temperaturbereich beträgt bei der neuen Serie 105°C bei der alten
85°C. Die Neuen haben etwa 1000 Stunden spezifizierte Lebensdauer
bei 105°C und darf danach einen Kapazitätsverlust von der
Größenordnung etwa -30% zeigen (man beachte, die Hersteller
spezifieren die Lebensdauer oft unterschiedlich). Nur 1000 Stunden
bei 105°C ? - das ist nicht so wenig, weil die Alterung gehorcht
einer exponentiellen Funktion vs. Temperatur, d.h. bei 25°C liegt
die Lebensdauer dann vielleicht bei geschätzt ca. ganz grob 40.000
Stunden.
Die Lebensdauer eines
Elektrolytkondensators hängt hauptsächlich ab:
-
von der Qualität
des Kondensators selbst
-
von der lokalen
Umgebungstemperatur im Verstärker selbst.
-
welche Rippleströme
der Kondensator tragen muß (eine Frage des Schaltungsdesign,
Bauteiledimensionierung und der Applikation), je höher der
Wechselstrom durch einen Kondensator, desto mehr innere Wärme
ensteht in ihm selbst und heizt ihn mit auf, die erhöhte
Temperatur wiederum begünstigt den stetig anhaltenden Vorgangs
des Verlustes an Elektrolyt, damit sinkt die Kapazität. Ein Low
ESR Elko wie die hier neu verbauten hat einen niedrigeren
inneren ohmschen Widerstand, nach p=i*i*ESR ensteht in ihm
weniger innere Wärme. Gerade für Anwendungen in Schaltungen, bei
denen er hohe Wechselströme tragen muß ist ein Low ESR ideal.
Für viele Anwendungen mit niedrigem Wechselstrom ist ein Low ESR
nicht erforderlich und ein Standard Typ in harmloser Umgebung
kann dabei sehr alt werden. Alle Typen ob Standard, Low ESR,
85°C, 105°C, oder 125°C haben alle ihre jeweiligen Vor- und
Nachteile.
Das Wechseln der
Kondensatoren war sinnvoll, besonders bei den beiden die total
defekt gewesen sind. Warum sind diese kaputt gegangen?, ich weiß es
nicht.
|
Power Amp
|
Nun
geht es an die große Leiterplatte mit den dicken Elkos. Die große
Leiterplatte selbst aus dem Gehäuse zu entfernen habe ich mir
gespart, das ist viel Kabellöterei und Geschraube, das Zerlegen ist
hier nicht so komfortabel wie das bisherige. Die Reinigung auf der
Unterseite mit Spiritus kann auch im eingebauten Zustand erledigt
werden, genauso geschah es auch mit dem Tauschen der Kondensatoren.
|
 |
 |
 |
|
Ich
kann's nicht lassen ständig zu zeigen, was auf dem Gebiet der Elkos
von allen Herstellern geleistet worden ist um die Baugröße zu
reduzieren, in diesem Fall sogar mit höherer Spannungsfestigkeit
(mehr Spannungsfestigkeit benötigt mehr Volumen, verglichen mit
derselben) dazu noch verbessertem Verlustfaktor und ESR vs.
Frequenz.
|
Auch
die Power Amp Leiterplatte ist zum Abschluß mit Schutzlack
überlackiert worden.
|
Nun
ist mal wieder ein Zusammenbau und ein erster Zwischentest von
Nöten. Alles Zusammengesetzt und Eingeschaltet - siehe da der Amp
läuft nun auf beiden Kanälen, aber noch nicht richtig getestet, das
kommt später.
|
 |
 |
 |
|
Der
Phonoverstärker befindet sich im hinteren Teil recht durchdacht
geschirmt zwischen zwei Blechen versteckt. Die Leiterplatte trägt
auch die Aux, Tape, Tuner Eingänge, Moving Coil und MM Eingänge. Die
ganze Platte besteht aus vielen Einzeltransistoren und
diskreten Bauteilen.
|
Eine
Reinigung des Phonverstärkers ist auch angesagt.
|
Neue
Kondensatoren für den Plattenspieler Verstärker.
|
|

|
Phono Verstärker
 |
 |
 |
|
Plattenspielerverstärker enthält bipolare Koppelelkos im Signalweg,
diese werden durch Folienkondensatoren ersetzt.
|
Elektrolytkondensatoren am Phonoverstärker
getauscht. Die oberere linke linke Ecke ist der Moving Coil Sektor,
die empfindlichsten Signale im Verstärker.
|
dickes Folienkondensator Paket mit Sekundenkleber aneinander
geklebt.
|
 |
 |
 |
|
die getauschten Elkos aus dem Phono Verstärker.
|
die Rückseite wird mit Spiritus gereinigt.
|
fertige Leiterplatte mit Schutzlack lackiert.
|
 |
 |
|
Überall Kabel und Leitungen wohin man schaut, sämtliche Potentiale
von klein bis hoch.
|
das Gerät hat keinen Schutzleiteranschluß, die Netzspannung verläuft
durch das Gerät von hinten nach vorne. Falls einer dieser Drähte
abkracht würde und das Gehäuse berühren sollte, liegt Spannung am
Gehäuse, gut kontrollieren.
|
|
Tone Control und erste Verstärker Stufe
|
 |
|
An die Vorderseite. Alufrontplatte runter, (erstaunlich einfach ging
das) den vorderen Deckel abklappen. Rechts die Umschalter, links der
eigentliche Vorverstärker für alle Signale, die Bass & Treble
Regler, Subsonic Schalter usw.
|
 |
 |
 |
|
ohne jetzt irgend jemandem zu Nahe treten zu wollen, die Art und
Weise wie das hier konstruktiv befestigt ist schon ein wenig ein
Gefummel. Zum Glück muß das hier nur selten geöffnet werden.
|
die beiden Leiterplatten und das Gehäuse
sind durch kurze Drähte miteinander verbunden. Die hintere
Leiterplatte hat einige Drahtbrücken. Guter Kontrast: rechts das
edle Poti, links viele Drähte.
|
Leiterplatte mit den Bass und Höhenreglern. Zu sehen sind die
kleinen gelben Folienkondensatoren statt der Elkos. Die beiden
dicken bipolaren 47µF Elkos wurden nicht ersetzt, sie bleiben drin,
sie sind noch ok. 47µF durch Folie zu ersetzen ist mir jetzt doch
etwas zu heftig in der Dimension.
|
 |
 |
 |
|
fertige Leiterplatte mit dem DC ON-OFF Schalter, Subsonic und High
Filter. Man beachte auch unten rechts im Bereich der Transistoren
die braune Verfärbung der Leiterplatte durch Wärme.
|
nach dem Reinigen und Lackieren sieht auch
die Rückseite der DC-ON-OFF Leiterplatte wieder richtig neu aus.
|
die Rückseite der Tone Control Leiterplatte mit dem Bass und Höhen
Regler nach dem Reinigen und Lackieren. |
 |
 |
 |
|
ausgetauschte Elkos, sie waren alle elektrisch noch in sehr gutem
Zustand. Die kleinen schwarzen links sind die bipolaren
Elektrolytkondensatoren.
|
Widerstände heizten der Leiterplatte ein.
Ein Wärmenest in der linken oberen Ecke. Dahinter das nächste
Öfelchen, Transistoren und Widerstände der anderen Platte.
|
230
Volt Netzschalter und Versorgungs und Signalleitungen.
|
|
Nun waren alle Bauteile
soweit getauscht, und es stand die Freude bevor den Verstärker
auszutesten. Gesagt getan - was ging? Nichts. In solchen Momenten
wächst der Ärger doch gewaltig, Stunden des Lebens verbracht in
voller Hoffnung und es geht nicht. Daraufhin getestet was es sein
könnte, dann endlich gefunden. Der DC-ON-OFF Schalter hat einen
üblen Wackelkontakt auch noch gleich auf beiden Kanälen, völlig
undefinierbar. Daraufhin den Schalter getauscht gegen den
funktionierenden aus dem Teileträger. Das auslöten erfordert etwas
Geduld, ist aber einfach.
|
|

|
genau in der Bildmitte
ist der DC On Off Schalter mit dem mechanischen Defekt. Bei dem
ersten Test ist das nicht aufgefallen, kann auch sein, daß das
vorherige auf und zusammenschrauben den Effekt begünstigt hat.
Rechts das Ersatzteil. Den Verstärker wieder zusammengeschraubt,
funktioniert. Ja nach dem Tausch von fast 100 Kondensatoren hat man
schon etwas ein mulmiges Gefühl ob gleich alles geht. Es ist immer
die Frage im Kopf, hab ich alle auch richtig gepolt eingebaut, ist
irgendwo einer der Drähte abgekracht usw.
|
 |
 |
|
die
Kontakte wurden zuerst mit Kontaktspray gut besprüht, danach mit
einer Sprühwäsche von den abgelösten Oxidschichten gereinigt. Beim
Benutzen des Kontaktspray versuchen dieses nur dahin zu sprühen wo
wirklich Kontakte sind, damit nicht zuviel umliegender Schmutz und
Oxidschichten mitgelöst wird, der nur wieder entfernt werden muß
falls er an die Kontakte gelangt.
|
die
Anschlußleitungen der Leiterplatten wurden etwas verlängert, daß ein
einfaches Messen an den Leiterplatten möglich wurde.
|
Wieder alles zusammengebaut
Die Reparatur Arbeiten wurden
in aller Ruhe ohne irgendwelche Hektik oder Zeitdruck erledigt. Dabei habe
ich mir genügend Zeit genommen auch zu versuchen die wesentlichen Elemente
dieses Verstärker Typen zu verstehen. Die Arbeiten wurden auf das
wesentliche und einfach machbare beschränkt. Man hätte noch einiges mehr
tun können um die Zuverlässigkeit zu steigern, sowie auch noch die
Klangqualität zu erhöhen, würde aber enorm viel Mehraufwand bedeuten.
Trotzdem sind bis jetzt etwa 50 bis 60 Stunden an Arbeit angefallen. Die
Arbeiten können nur mit dem Hintergrund der Begeisterung und dem Gewinn an
Erfahrung begründet werden, aus wirtschaftlicher Sicht darf man an solche
Arbeiten erst gar nicht rangehen, besser erst gar nicht dran denken -
stehen in keinem Verhältnis zum Gegenwert des Verstärkers.
Der Bericht soll auch ein wenig die Leute nachdenklich stimmen, die der
Ansicht sind: "sich mal schnell ein defektes Gerät günstig zu kaufen oder
zu ersteigern" und dann versuchen wollen es an einem Nachmittag repariert
zu bekommen. Geht manchmal nicht so locker easy wie viele es sich
vorstellen und Werkstätten damit zu beauftragen kann teuer werden, da auch
diese viel Zeit investieren müssen, obwohl sie bereits eventuell Erfahrung
mit diesem Typen mitbringen. Werkstätten stehen bei den hohen
Stundensätzen in Deutschland, die sie verlangen müssen, unter hohem Druck
das Gerät mit geringem Zeitaufwand zu reparieren. Für
Schönheitsoperationen wie alle Elkos tauschen ist da keine Zeit, obwohl
der Reparierende sicher sehr gern mehr Zeit mit dem Gerät verbringen
würde.
Wohl dem der das alles selbst erledigen kann.
Der Bericht soll aber auch Besitzer dazu motivieren, zumindest mal darüber
nachzudenken beim nächsten Defekt ähnliche Maßnahmen zu ergreifen.
Elektrotechnische Kenntnisse sind eigentlich nur für die Reparatur an sich
erforderlich, die restlichen Arbeiten sind nur Fragen des handwerklichen
Geschicks.
Zum Abschluß noch ein paar ernstgemeinte Hinweise an Besitzer:
-
schließe bitte niemals die Endstufe am Ausgang kurz,
auch nicht für einen kurzen Moment
-
pass auf beim Anschließen der Lautsprecher Kabel
-
verdrille sie gut, verlöte zuvor leicht die Enden
-
verwende keine zu dicken Kabel, die nicht in die Buchsen passen
-
ziehe die Klemmen am Gerät und am Lautsprecher gut an, kontrolliere
regelmäßig die Festigkeit aller Anschlüsse an Verstärker und
Lautsprecher
-
die Drähte dürfen sich nicht berühren, auch kein Kontakt zum Gehäuse
-
behandle das im Zimmer verlegte Kabel schonend
-
vor dem Anschluß der Lautsprecher (besonders fremde, die noch nie am
Verstärker liefen) sollten immer mit einem Ohmmeter zwischen Plus und
Minus am noch nicht angeschlossenen Kabel gemessen werden. Die
Genauigkeit des Ohmmeters ist hier kaum von Bedeutung. Der abgelesene
Meßwert sollte in der Größenordnung des Nennwerts der
Lautsprecherimpedanz liegen, z.B. 4 oder 8 Ohm. Keinenfalls
Lautsprecher anschließen, bei denen das Ohmmeter nur sehr geringe
Werte anzeigt.
- lese die Bedienungsanleitung
Viel Spaß beim Hören.
|